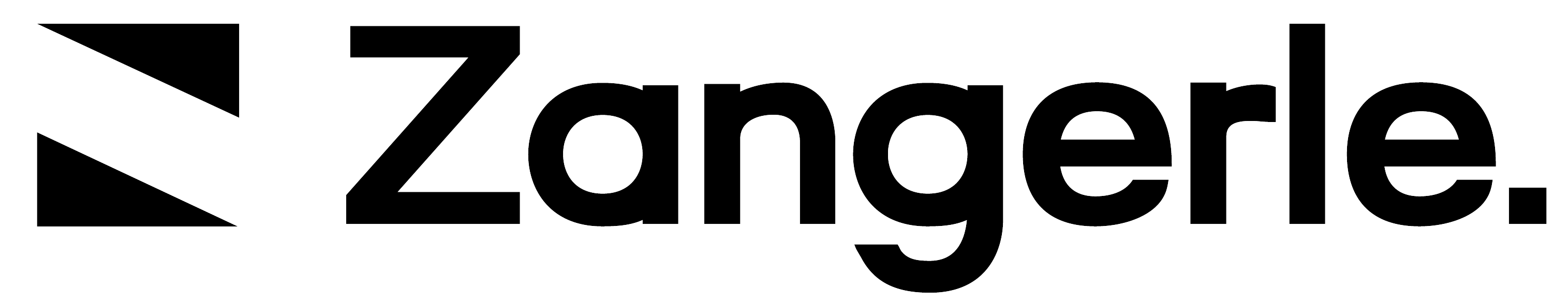Wer ein Unternehmen gründet, sollte sich vorab intensiv mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, den unterschiedlichen Rechtsformen und den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Das ist vor allem empfehlenswert, wenn mehrere Mitgründer (Co-Founder) im Gründungsvorhaben involviert sind. Hier muss schon vor der Gründung entschieden werden, wie und in welcher Form die Unternehmensanteile verteilt werden. Neben dem Gründungsvertrag gibt es für angehende Unternehmer auch die Möglichkeit, einen (außerhalb der Startup-Szene recht unbekannten) Vesting-Vertrag zu vereinbaren. In diesem Beitrag erkläre ich, was ein Vesting-Vertrag ist, wozu er dient und warum meiner Meinung nach alle Startup Gründer eine Vesting-Vereinbarung unterzeichnen sollten.
Was ist ein Vesting Vertrag?
Ein Vesting-Vertrag (oder eine Vesting-Klausel) ist eine Regelung, die einem Unternehmen die Möglichkeit verschafft, Anteile der Gründer entziehen zu können, wenn diese das Unternehmen vorzeitig verlassen. Dabei wird typischerweise eine Vesting-Laufzeit vereinbart, die die Gründer mindestens im Unternehmen verweilen müssen. Diese Laufzeit beträgt in der Praxis zwischen 3 und 7 Jahren. In diesem Zeitraum muss sich der Gründer durch die Arbeit im Unternehmen seine Anteile „verdienen“. Was bedeutet das genau?
Beispiel: „Vesting-Vertrag“
Nach 2 Jahre und 3 Monaten entscheidet sich Gründer B, das Unternehmen zu verlassen, weil er nicht mehr motiviert ist. Gründer B hat sich somit 27/60 seiner Anteile verdient (das sind 13,5% des Unternehmens) und darf diese behalten. Die zwei übriggebliebenen Gründerinnen haben nun aber das Recht, die restlichen 16,5 % Unternehmensanteile von Gründer B zurück zu kaufen.
Das „Vesting“ (auf Deutsch: die Übertragung) der Anteile soll also einerseits sicherstellen, dass ein Gründer auf Dauer motiviert bleibt und andererseits, dass auch nur jene Gründer zur Gänze am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind, die auch dazu beigetragen haben.
Good Leaver und Bad Leaver
Im Vesting-Vertrag werden zudem auch noch zwei Szenarien behandelt. Die „Good-Leaver“ und die „Bad-Leaver“-Situation. Von einem Good-Leaver spricht man, wenn die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet wird, der Gründer sich aufgrund gesundheitlicher/familiärer Gründe oder aus den im Vertrag genannten Gründen zurückzieht. Von einem Bad-Leaver spricht man dann, wenn ein Gründer gegen Bestimmungen des Vertrages verstoßen hat (z.B., wenn er das Unternehmen verlässt. um ein Konkurrenzunternehmen zu gründen) und das Unternehmen verlässt.
Die Einordnung in Good-Leaver und Bad-Leaver hat eine Auswirkung auf die Höhe des Kaufpreises der Anteile, die die anderen Gründer zurückkaufen können. Handelt es sich beim ausscheidenden Gründer um einen Good-Leaver, so bekommt dieser in der Regel den aktuellen Marktpreis für seine Anteile. Bei einem Bad-Leaver beträgt der Kaufpreis jedoch nur jenen Betrag, zu dem der ausscheidenden Gründer auch eingestiegen ist.
Die Vor- und Nachteile eines Vesting-Vertrags
Wie bereits erwähnt, dient der Versting-Vertrag vor allem dafür, eine faire Regelung für die Anteile der Gründungsmitglieder zu schaffen. Das hat den Vorteil, dass es im Falle eines vorzeitigen Ausstiegs eines Mitgründers später zu keinem Streit oder einem juristischen Nachspiel kommt. Zudem haben die Gründer einen zusätzlichen Anreiz bis zum Ende der Vesting-Vereinbarung im Unternehmen zu verbleiben. Das bietet nicht nur für Gründer eine gewisse Sicherheit, sondern auch für Investoren, die das Unternehmen mit finanziellen Mitteln unterstützen. Eine Vesting-Klausel ist daher häufig auch in Beteiligungsverträgen bei Investments zu finden.
Diese Bindung der Gründer kann aber gleichzeitig auch als Nachteil gesehen werden. So muss man sich als Gründer vielleicht die ein oder andere Geschäftsidee entgehen lassen, weil man vertraglich noch an das alte Unternehmen gebunden ist und man seine Anteile nicht verlieren möchte.
Fazit
Eine Vesting-Vereinbarung bindet die Gründer für eine bestimmte Laufzeit an das Startup. Steigt ein Gründer vorzeitig aus, so muss er seine restlichen Anteile den übrigen Gründer zu einem bestimmten Kaufpreis (davon abhängig, ob Good-Leaver oder Bad-Leaver) anbieten.
Eine Vesting-Vereinbarung bietet somit sowohl für Gründer als auch für Investoren eine gewisse Sicherheit und ist daher aus meiner Sicht grundsätzlich allen Neugründern zu empfehlen. Das Gründungsteam ist ja bekanntlich das „Herz“ eines jeden Startups und die Gründer sollten darauf achten, dass dieses Kernteam auch möglichst lange im Unternehmen bleibt.